Dr. Michael Grisko ist nach Stationen an der Universität, beim Fernsehen und am Museum seit 10 Jahren Kultur- und Stiftungsmanager in Erfurt.
Was hat Einkaufen mit Kultur zu tun? Nichts, so scheint es im Moment. Während die Supermärkte und Drogerieketten, die Onlineversandhäuser und die Paketdienstleister ihre „Systemrelevanz“ mit wachsenden Umsatzzahlen und steigenden Börsenkursen honoriert bekommen, man die Innenstädte abends lediglich mit fahrenden Pizzaboten teilt, haben die Museen und andere Kultureinrichtungen geschlossen.
Im besten Fall buhlen diese mit mitunter schnell gestrickten digitalen Lösungen in einem Meer teils gesichtloser Angebote um Sichtbarkeit, kümmern sich unsichtbar hinter verschlossenen Türen um ein „Weiter so wie bisher“ nach dem Lockdown und üben sich in brav wiederholter Bedeutungsrhetorik.
Und doch könnten wir etwas aus dieser Zeit des verordneten „So-nicht-weiter“ lernen. Denn – so meine Meinung – Einkaufen hat doch etwas mit Kultur zu tun. Oder anders formuliert, fordert der Blick auf die Gegenwart einen Bewusstseinswandel auf Seiten der Anbieter kultureller Dienstleistungen heraus. Dabei steht nichts weniger im Mittelpunkt als eine Neudefinition der Kund*innen- bzw. Nutzer*innenbindung in den Kulturinstitutionen.
Und dabei spreche ich nicht davon, automatisch mehr Angebote ins Netz zu verlagern, das wird ohnehin nicht aufzuhalten sein oder immer mehr auf den „entauratisierten“ und „entsozialisierten“ Zugang zur Kunst zu setzen und damit den institutionellen und interaktiven Charakter der Kultur zu verändern – auch das wird so oder so passieren.
Vielmehr braucht es zur Begleitung dieses ohnehin nicht zu stoppenden Prozesses, der flankiert wird von einem radikalen Anspruchs-, Nutzungs- und Bedeutungswandel der Institutionen und der NutzerInnen einer neuen Generation (geschult an Netflix und co.!), ein modernes, in seiner Zugänglichkeit, Kommunikation und inhaltlichen Aufstellung dienstleistungsorientiertes NutzerInnenangebot, das uns individuell, vertrauensvoll, zuverlässig und mit Mehrwert anspricht.
Emotionale Ansprache durch langjährige und verlässliche Kundenbindung
Denn mal Hand aufs Herz: Was hat uns in den letzten Monaten emotional angesprochen, unsere Kaufentscheidungen beeinflusst? Verfügbarkeit, Bequemlichkeit, die Notwendigkeit den lokalen Einzelhandel zu stärken (auch wenn dies manchmal mit Mehraufwand verbunden war), aber vor allem eine durch positive persönliche Erlebnisse gewachsene Kund*innenbindung, die die Hauptquelle war für empathische und finanzielle Solidarität und dementsprechender Nutzung und Unterstützung.
Es gibt keine Studie dazu, aber der Mehrwert, der in jüngster Vergangenheit durch (langjährige) Freundlichkeit, individuelle Ansprache, nutzbringende Hinweise (ich will nicht von Werbung sprechen, aber wer bekommt nicht lieber Hinweise, mit denen man etwas anfangen kann?), Ansprech- und Erreichbarkeit, Verlässlichkeit und Vertrauenswürdigkeit erzielt wurde, ist sicher immens. Sollte das nicht auch Vorbild für Kulturinstitutionen aller Art sein?
Geht man davon aus, dass die zur Zeit viel diskutierte Relevanz (deren Begründung auch ein breites Spektrum haben kann) nicht zuletzt durch Kommunikation und im Auge des/der Nutzers/in entsteht, müssen wir uns die Frage stellen, warum wir diese (vielleicht subjektive) Erkenntnis nicht intensiver für ein zukünftiges Institutionenmarketing und Nutzer*innenmanagement nutzen.
Lernen von Onlineriesen?
Und warum das Ganze nicht professionell angehen und dabei auch von den Stärken der Onlineriesen lernen. Diese haben in den letzten Jahren zahlreiche Instrumente zur Kund*innenbindung und individueller Ansprache entwickelt, die nicht nur habitualisiert wurden, sondern auch von der Empfehlung über die Bewertung bis hin zur Vernetzung – Nutzer*innen, denen dieses Kunstwerk gefallen hat, haben sich auch dieses angeschaut oder empfehlen dieses Buch, diesen Film, diese Internetseite -, zahlreiche Möglichkeiten zur Präferenztransparenz (im beiderseitigen Einverständnis) geschaffen haben. Dabei sind dies nur erste Möglichkeiten, die Kultur nicht einfach kopieren, sondern strategisch adaptieren könnte.
Zumal mit Blick auf die Museumsshops und weitere Verkäufe ein Kanal geschaffen würde, der nicht nur Umsätze, sondern auch Kundenbindung generiert. Denn die Häuser, die ihre Nutzer*innen kennen, einen Kanal, die Vertrauen und Verlässlichkeit, möglicherweise sogar eine differenzierte Ansprache zu ihnen aufgebaut haben, konnten diese für eine entsprechende Kommunikation, bis hin zur Anbindung an den Museumsshop, der dann natürlich zuverlässig bedient werden musste, nutzen.
Es ist offensichtlich: Je mehr wir über unserer Nutzer*innen wissen, umso bessere Angebote können wir machen. Aber es sind nicht nur die Inhalte, sondern auch die nach außen getragenen Soft-skills, (Vertrauen, Verlässlichkeit, Freundlichkeit), das mit einem Haus und seinen Mitarbeiter*innen verbundene Image, die Werte, die in den Nutzer*innenbeziehungen von entscheidender Bedeutung sind.
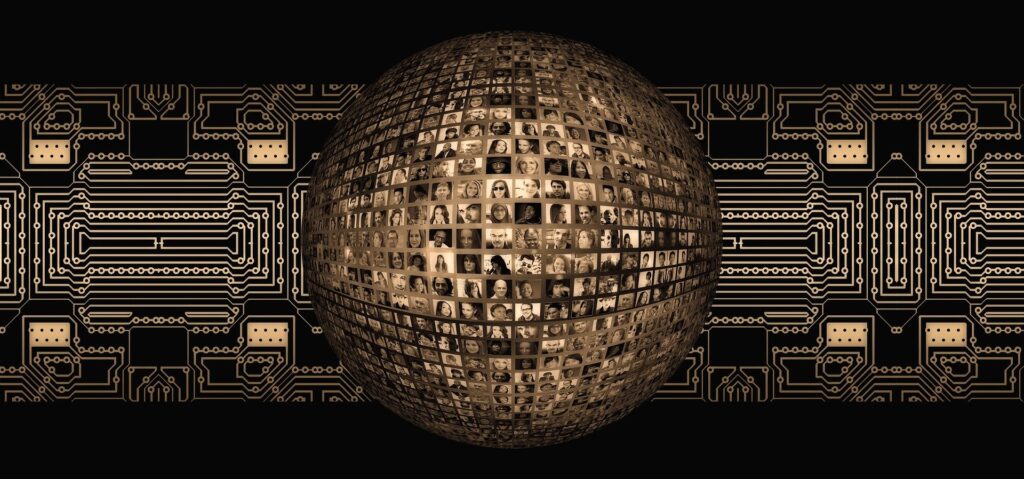
Je differenzierter – je diverser? Je persönlicher – je relevanter?
Werte und Häuser sollten sich weiterentwickeln. Deren Charakter sollte sich in Korrespondenz mit einem immer stärker ausdifferenzierteren Wissen hinsichtlich der Wünsche, Vorlieben, Interessen der Nutzer*innen ergeben. Und aus diesem Wissen folgend eine persönliche, differenzierte Ansprache, mit entsprechenden Angeboten und Zugängen ermöglichen.
Warum also nicht seine Kund*innen (noch besser) kennenlernen, sie nach Ihren Bedürfnissen fragen, im Rahmen der datenschutzrechtlichen Möglichkeiten auch digitale Daten auswerten und natürlich auch eine entsprechend ausdifferenzierte Ansprache entwickeln? Und demzufolge entsprechende Angebote nicht nur in der Institution, sondern auch in der klassischen Kundenansprache über Newsletter und andere Medien, ausspielen und diese auch im Museumsbesuch nicht mehr nur dem Alter nach ausdifferenziert, vorlegen?
Denn es sind nicht nur die Jungen und Alten, die Chines*innen, Inder*innen und BritInnen, sondern auch die Expert*innen und Neulinge, die Kreativ-Denkenden und die Analytiker*innen, die vielleicht einen anderen Zugang, eine andere Ansprache brauchen. Und dies sind zugegeben sehr schematische Kriterien, die einer ausdifferenzierten Gesellschaft wenig gerecht werden. Die Marktforscher*innen, auch die Touristiker*innen sind in dieser millieu-und nutzer*innen-orientierten Ausdifferenzierung noch viel weiter. Warum findet dieser Ansatz in der kulturellen Arbeit so wenig Resonanz? Geld? Institutionelle Angst? Fehlende Ausbildung? Erste Ansätze dazu finden sich vielleicht in einer großen über zwei Jahre angelegten Besucher*innenumfrage in Gotha, Halle, Chemnitz und weiteren großen Institutionen.
Es muss etwas passieren, denn nicht alle Nutzer*innen kommen am Tage der Öffnung automatisch wieder. Vielleicht gelingt in einem längeren Prozess so auch die Ansprache einiger Nichtbesucher*innen. Es ist eine neue Form von nutzer*innen-ortierter Relevanz.
Zudem habe ich die Angst und die Vermutung, dass der an einigen Orten durchaus vorhandene Wille zur Veränderung in der Breite nicht ankommt oder der Wille zur Veränderung in einer dynamischen, von Sparzwängen und disruptiven Prozessen geprägten Kulturentwicklung nicht reicht.
Dabei soll nicht einer unkontrollierten Datensammelwut das Wort gedreht werden, vielmehr soll der Blick für die Möglichkeiten und Notwendigkeiten eines zielgruppenorientierten und individualiisierten Angebots geöffnet werden. Denn warum sollen Banken und Onlineriesen mit diesen Instrumenten Geld verdienen und die Kultur auf den möglichen Mehrwert verzichten? Am Ende könnte dies auch ein wenn auch minimaler Beitrag zur Diversität einer Institution sein.


